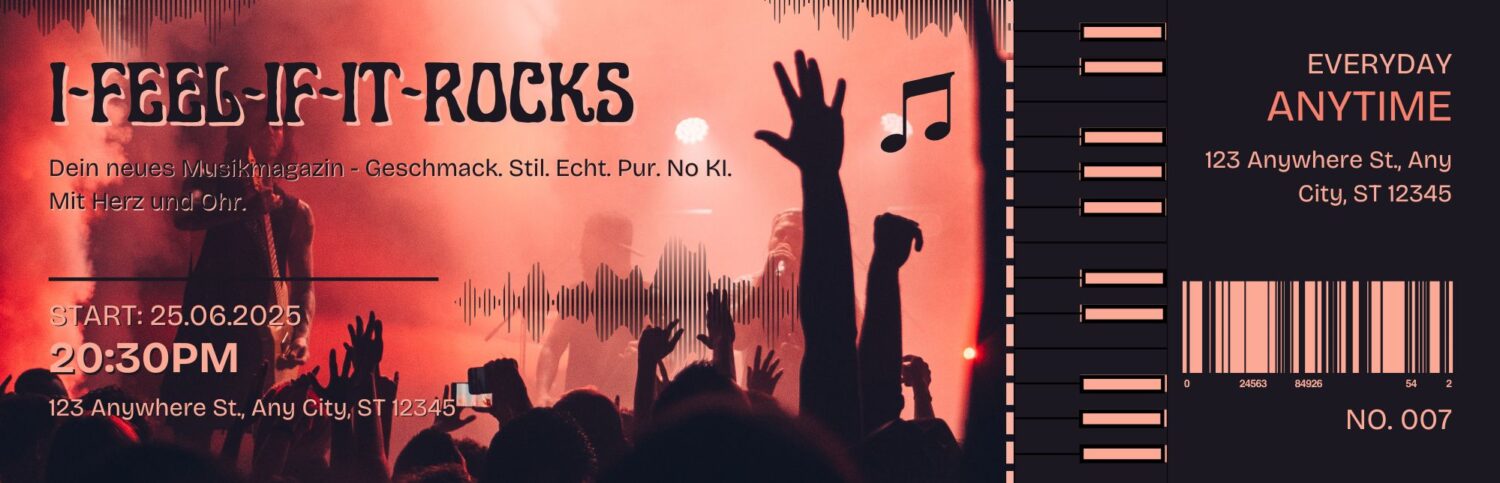KI-Musik: Matschepampe auf allen Kanälen
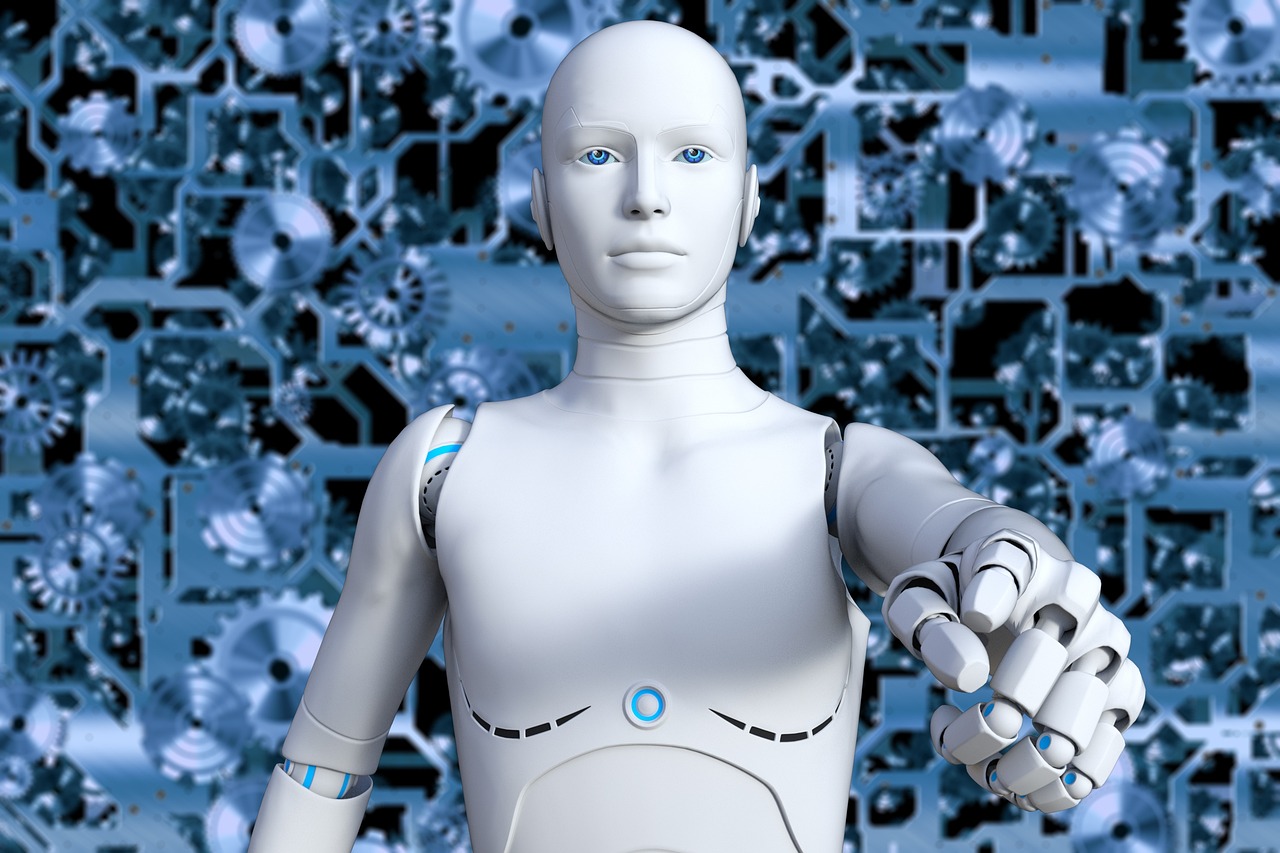
Zugegeben der Titel ist etwas provokant, und auch nur ein Zitat. Denn vieler User beschweren sich bereits über die „Matschepampe“, die spotify und andere Musikstreaming-Plattformen aktuell überschwemmt.
Fakt ist: Aktuell wird viel Schindluder mit KI-Musik betrieben. Es werden Künstler geklont und es werden Werke prominenten Musikern zugeschrieben, unter ihrem Profil hochgeladen, die eigentlich künstlich und schnell generiert wurden.
Die Ersteller greifen so Traffic und damit Verdienst ab, der ihnen nicht zusteht. Das ist aber auch nur ein Punkt. Der Ausdruck „Matschepampe“ stellt recht deutlich dar, wie KI-Musik auf Musikfans wirkt: Ein Einheitsbrei ohne Herz und Seele, auf den man getrost verzichten kann.
KI lernt aus Mustern, nicht aus „Kopien“
Beim Training analysiert die KI riesige Datenmengen – Millionen von Musikstücken. Dabei „hört“ sie aber nicht im menschlichen Sinne zu, sondern verarbeitet digitale Informationen: Tonhöhenverläufe, Rhythmusstrukturen, Harmonien, Timbre (Klangfarbe), Texturen oder auch Songstrukturen. Sie erkennt:
- Welche Akkordfolgen häufig vorkommen,
- Welche Melodien und Sounds typisch für bestimmte Genres sind,
- Welche Sounds oder Instrumente oft miteinander kombiniert werden.
Das Ergebnis: Die KI lernt Wahrscheinlichkeiten und Muster. Daraufhin erzeugt sie Musik, die sich an diesen Mustern orientiert – ohne zwingend Passagen zu übernehmen.
Obwohl die KI keine Musikstücke direkt kopiert, bleibt ein rechtliches Problem: Die Trainingsdaten bestehen eben aus urheberrechtlich geschütztem Material.
Und da die KI durch diese Daten überhaupt erst in der Lage ist, „neue“ Musik zu generieren, stellt sich die Frage:
Muss die Nutzung dieser Werke nicht ebenfalls lizenziert oder vergütet werden – auch wenn kein konkretes Zitat entsteht?
Neue Technologien im Einsatz
- Diffusionsmodelle oder Transformer-Modelle (wie bei Text-KI) können heute Musik über viele Minuten generieren – mit Strophen, Refrains, Struktur.
- Manche KI-Tools erzeugen Musik „symbolisch“ (z. B. in MIDI), andere direkt als Audio.
- Modelle wie Suno, Udio oder MusicLM (Google) erzeugen Gesang, Text und Begleitung auf Knopfdruck – teils in Radioproduktionsqualität.
Inspiration oder Imitation?
KI in der Musik basiert auf statistischer Kreativität, sie arbeitet also eher mathematisch, kombiniert Erlerntes zu etwas formal Neuem.
🟦 Lies auch: Diese Band begeistert Millionen bei Spotify – aber ist sie real?
Höchst wahrscheinlich ist diese Band nicht existent. Die Musik klingt gut, nach ehrlichem 70er Jahre Stuff. Aber was nützt das den Fans, wenn es keine reale Band, keine realen Menschen dazu gibt?
Gut, betrogen und gelogen wurde in der Musikindustrie wohl schon immer. Man erinnere sich an den Skandal um Milli Vanilli, die nur gut aussehende Tänzer waren und null Stimme hatten. Oder Frank Farian, der selbst die männliche Stimme von Boney M. war, aber den akrobatischen Tänzer auf die Bühne vorgeschickt hat.
Jedenfalls war es immer ein Skandal, wenn so etwas herauskam, denn die Fans wollen eine echte Identifikation mit der Musik und den Stimmen. Was jetzt wohl viele Musikproduzenten tun werden ist: Mit der KI schnell alles vorzuproduzieren und sich dann eine Band zusammen zu casten. Nichts Verbotenes, aber auch irgendwie wieder seelenlos.
Potenziale der KI für Musikschaffende
- KI-Tools unterstützen beim Songwriting, bei Komposition und Produktion.
- Managementaufgaben lassen sich schneller lösen.
- Für Menschen mit Einschränkungen kann KI neue Zugänge zur Musik schaffen – Stichwort Barrierefreiheit.
- Unabhängige Künstler:innen nutzen KI für experimentelle Klangprojekte.
Aber: Muss Musik zur schnell verfügbaren Masse werden, wozu? Brauchen wir in der Musik wie in der Mode jetzt auch Wegwerfsongs? Und ist es wirklich von Vorteil, wenn ein Song „schnell“ entsteht…
Kritische Fragen rund um Urheberrecht
- Künstliche Intelligenz lernt aus bestehenden Daten – oft aus urheberrechtlich geschütztem Material.
- Aktuell fehlen klare internationale Regelungen, wie solche Werke genutzt werden dürfen.
- In Europa bringt der AI Act erste Vorgaben, z. B. zur Transparenz, doch vieles bleibt ungeklärt.
- In Deutschland setzen sich Institutionen wie der Deutsche Musikrat und die GEMA für klare Lizenzmodelle ein.
Erste rechtliche Schritte – Beispiel GEMA
- Im September 2024 stellte die GEMA ein Lizenzmodell für KI-Nutzung vor.
- In der Folge reichte sie Klage gegen OpenAI und Suno AI ein – wegen unlizenzierter Nutzung von Musik zum Training ihrer Systeme.
- Die Sorge: Kreative verlieren ihre Einnahmequellen, wenn ihre Werke unvergütet verwendet werden.
Quelle: Deutsches Musik Informationszentrum Beitrag KI-Musike Intelligenz